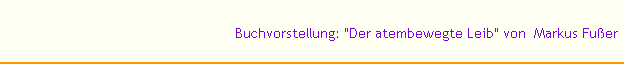|
Zwischen Bewusstsein und Erleben
Markus Fußer schließt die als Erfahrungsgebiet gegebenen Atempraktiken des Westens theoretisch auf
Markus Fußer, Der atembewegte Leib.
√úber die westliche Arbeit mit der Hand, dem Laut und der Bewegung, Atemraum, Karlsruhe 2003
Die Ph√§nomenologie eines Maurice Merleau-Ponty sagt uns: Alles was ich wei√ü, tue, f√ľhle und empfinde wird durch meine existenzgebundene
Welterfahrung organisiert. Der Atemlehrer f√ľgt hinzu: Diese ist in ihrer bio¬≠grafischen Gewordenheit in der Atembewegung konsolidiert. Vor allem Wahrnehmen, Denken und Sprechen des Ichs wertet die Person
sensorisch im Verhältnis von Innen und Außen durch den atembewegten Leib. Durch seine animalische Erbeschaft ist dem Menschen ein vital-sensorisches Resonanzreich der vorsprachlichen Informationsverarbeitung durch
die Atembewegung mitgegeben. Die Verschr√§nkung von Atemleib und Bewusstsein ist dem Ich jedoch nur indirekt zug√§nglich und bleibt ihm nahezu unverf√ľgbar.
Sind die Akte des Ichs an den Leib angejocht, existiert ein R√ľckhalt, durch welchen Selbstsicherheit gewonnen wird.
Das Tun und Lassen erscheint stimmig. Wohlbefinden entsteht, weil die Atembewegung befreit schwingt. Das willentliche Tun hallt in den leiblichen Empfindungen wider, wodurch es unbewusst korrigiert und geschmeidig
gef√ľhrt wird. Doch der Leib kann mit seinen Bed√ľrfnissen auch in Widerspruch zum Bewustsein geraten. Missbefinden macht sich breit. Werden die leiblichen Appelle nicht vom Ich angenommen, kann die Handlung
zerfallen und die Verhaltenssicherheit ausrinnen.
Wegen des möglichen Widerspruchs zwischen Bewusst­sein und Befin­den treten die verschiedensten Körper- und
Atemtherapien nicht nur mit dem berechtigten Anspruch auf, Grenzen der traditionellen Psychotherapien zu √ľbersteigen. Manche behaupten gar, dass ‚Äěder K√∂rper ... nicht‚Äú l√ľge. Doch derartigen Postulaten
anthropologischer Unmittelbarkeit ist zu widersprechen. Die leibliche Auskunft kann nicht von vornherein besser dran sein, weil zwischen Wahrnehmung und Empfinden eine Differenz existiert. Wegen ihr ist dem Menschen
ein erkenntnistheoretisches Problem aufgegeben. Die metaphysische Kehre von Emmanuel Kant begr√ľndet sich n√§mlich darin, dass wir die Gesetze der Natur nicht in dieser direkt erkennen, sondern dass wir unsere
Anschauungen in diese hineinlegen.
Einfache Antworten scheinen ausgeschlossen. Zunächst hintergeht der unmittelbare Blick auf die
Emp­fin­dungs­daten in den Körper- und Atemarbeiten die absolute Selbst­gewiss­heit, wie sie dem carte­sia­nischen Ich zukommt, das zum Ausgang des neuzeitlichen Denkens und der Wissenschaften wurde. Dieses
ist bekanntlich so pur tran¬≠szen¬≠den¬≠tal, dass es sagen kann: ‚ÄěIch bin, weil ich denke‚Äú. Gegen diese Verengungen der transzendentalen Bewusstseinsrationalit√§t wurde philo¬≠so¬≠phie¬≠ge¬≠schicht¬≠lich
zun√§chst die Praxis und schlie√ülich das Leben ins Feld gef√ľhrt.
Im vergangenen Jahrhunderts wurde mit zivilisationskritischem Duktus der Atemleib als Erfahrungsgebiet erkundet. Die
Sackgassen sind inzwischen un√ľbersehbar: Die eine f√ľhrt in eine welt¬≠fl√ľch¬≠tige Spiritualit√§t, die √∂stlich beliehen daherkommt, um das Denken selbst als Schein zu entlarven. Die andere rationalisiert mit
wissenschaftlich-technischer Inbrunst die K√∂rper¬≠beherr¬≠schung. Sie folgt der sich selbst zwingenden Selbstt√§gigkeit, die sich gegen√ľber dem eigenen Leib in Distanz verh√§lt. Die Pioniere der westlichen
Atemarbeit haben den dritten Weg einer Lebenskunst gesucht, auf dem die biologischen Tendenzen zur Vollatembewe­gung freigesetzt werden: Diese bergen eine Programmstruktur der Selbst­bewe­gung mit einer
produktiven und kreativen Haltung zur Welt.
Selbstgewissheit
Atemerfahrungen scheinen zunächst alle erkenntnistheoretischen Probleme um den Status von Selbsterfahrungen
zuzuspitzen. Sie stellen den √úbenden mit ein¬≠zigartiger Klarheit in eine doppeldeu¬≠tige Situation: Wenn dieser beim Belauschen der eigenen Atem¬≠be¬≠we¬≠¬≠gung Empfindungen erlebt, so gr√ľnden diese zun√§chst in
einer Realität, die sich fundamental von jener seines Atemflusses unterscheidet, auf den er gar nicht ach­tet, wenn er beim gelungenen Handeln seine Sinne auf eine Sache oder den anderen ausgerichtet hat. Die Krux
dabei ist, dass die empfindende Selbstzuwendung eine Atembewegung schafft, die den eingenommene ufmerk­sam­keitsmaßen im Verhältnis von Hingabe und Achtsamkeit entspricht.
So ohne weiteresf√ľhrt also kein direkter Atemweg zu einer allgemeing√ľltigen Wahr¬≠heit. Sollen Atemerfahrungen als
Erleben innerer Abläufe nicht ins Belieben abgleiten, ist ein schmaler Weg zu be­gehen. Sein Abweg ist die Selbstproduktion von Atemstörungen durch die Selbstzuwendung. Alle westlichen Atemschulen
qualifizieren ihre Methoden und Übungsweisen darin, der leichten Störbarkeit des Atems zu begegnen.
Es gilt sich mit Sammlungskraft so in die Atem­bewegung einzuschmiegen, bis schließlich alle wollende und
beabsichtigende, beobachtende und wertende Bewusstseins¬≠aktivit√§t untergeht. Erst wenn das pure Erleben eingekehrt ist, kann der unwillk√ľrliche Eigenrhythmus freiwerden. Indem die Sammlung als √úbergangsfeld
zwischen Bewusstsein und Erleben alle Eigenschaften des Ichs verliert und sich als personale Beziehung in den eigenen Atemleib einlässt, wird ein Zugang zum Atem als Kardinalbe­zie­hung der Transzendenz
m√∂glich. Durch eine gesammelte Atemweise entsteht Erfahrbarer Atem (Ilse Middendorf), der wegen dem Untergang des verstehenden Ichs sein ‚ÄěGeheimnis der Immanenz‚Äú (Wilhelm Szilasi) bewahrt.
Verbessert sich der Atemfluss, können die Ich-Kräfte des Übenden einen gebietenden Aufruf aus der leiblichen
Zustandsbefind¬≠lichkeit erfahren. Dar√ľber kann sich eine Gewiss¬≠heit √ľber die eigene Existenz ausbilden. W√§hrend wir durch die verstehende und deutende Analyse seelisch-geistiger Inhalte inne werden, leben
Atemerfahrungen durch das Erleben pr√§gnanter Empfindungen von einem Erf√ľllungs¬≠charakter, durch welchen die Person aufgerufen wird. Der Kern der Person ist nur durch Begegnung zug√§nglich, die das unbekannte
Innere regieren und das Fremde in das Eigene aufnehmen lässt.
Entspannung und Lösung
Fußer spinnt anhand der theoretischen Durchdringung der Atemlehre von Ilse Middedndorf einen Leitfaden, mit dem sich die verwirrende Vielfalt der
heutzutage angebotenen Verfahren ordnen l√§sst. Die Frage der Beteiligung der Person ‚Äď als Bindung der eigenen Stellungnahme zur Welt und zu sich selbst an die Leiblichkeit ‚Äď arbeitet der Autor als das
wesentliche Kriterium heraus, anhand dessen sich die verschiedensten Verfahren bewerten lassen. Ohne per­so­nale Beteiligung kommen Entspannungstechniken aus und alle Praktiken werden gar im schlechten Sinne zu
Entspan¬≠nungs¬≠√ľbungen, wenn sie ohne inneren An¬≠schluss an die Person ausgef√ľhrt, also nur ‚Äěgemacht‚Äú werden.
Gegen√ľber Entspannungstechniken mit ihrem suggestiven Einschuss betonen die westlichen Atemlehren, dass es die
Person ist, die at­met. Man spricht deshalb von Lösung durch Atemerfahrungen. Außerhalb der personalen Ge­rich­­tet­­heit der Sinne auf die eigene Atembewegung liegt auch die instrumentelle Nutzung des Atems
f√ľr psycho¬≠the¬≠ra¬≠peu¬≠tische Zwe¬≠cke. Der Personalit√§t ebenfalls enthoben sind yogis¬≠ti¬≠sche Selbst¬≠ver¬≠¬≠sen¬≠kungs¬≠prak¬≠tiken, die √ľber die Neu¬≠tra¬≠lisierung der Schwer¬≠kraftreize auf die
Erlebnislogik des ‚ÄěAll¬≠¬≠seins‚Äú abzielen. Die Selbstver¬≠senkung ist letztendlich darauf angelegt, das ‚ÄěIn-der-Welt-sein‚Äú (Martin Hei¬≠deg¬≠ger) im Nichts aufzuheben.
Der Status von L√∂sungsmethoden kann damit beschrieben werden, dass das Ich noch die F√ľhrung innehat.
Und die K√∂rperpsychotherapie will durch den instrumen¬≠tellen Nutzen des Atems dieses Ich wieder in sein Recht einsetzen. Beim Er¬≠¬≠fahrbaren Atem dagegen hat das transzendentale Ich endg√ľltig ausgespielt. Der
unersetzlich Andere wird zum Grund der menschlichen Begegnung.
Kaum eine andere manuelle Ma√ünahme kann in ihrem Einf√ľhlen die Person des anderen so klar ansprechen, wie die
Behandlung, die sich auf die Atembewegung direkt bezieht. Der Kontakt in der Atembehandlung f√ľhrt zu einer koh√§renten sensorischen Verschr√§nkung der Leiber, innerhalb der sich zwei Personen in ihren
Eigenrealitäten aufrufen, um einander zu begegnen.
Atemgestalten
Zum Auftakt seiner Aufsatzsammlung befragt Fu√üer eine Aussage von Ilse Middendorf. Kann ‚ÄěAtmen ein geistiger
Vorgang‚Äú sein, wenn das midden¬≠dorf¬≠sche Verfah¬≠ren lediglich auf der Grundformel ‚ÄěAtmen ‚Äď Empfinden ‚Äď Sammeln‚Äú beruht und damit die mit dem ‚ÄěGeheimnis der Immanenz‚Äú gegebene psychische Indifferenz
der Atembewegung wahrt? Die Philo­sophie eines Kant spricht Empfindungen nur subjektivistische Belie­big­keit zu, weshalb Mid­den­dorfs insistieren auf das geistige Invol­viertsein des Atmens eine Zu­mutung
f√ľr die transzendentale Rationalit√§t darstellt.
Die Entdeckungen der westlichen Atempioniere wurzeln in einem strukturgesetzlichen Gebiet, auf dem die
transzenden­talen Unter­schei­dungen von Körper und Seele, Materiellem und Ideellem sowie Subjekt und Objekt gar nicht gelten. Weder die christliche Tradition eines gleichblei­benden und immerzu neu
durchscheinenden Wesens noch der archaische Atem¬≠mythos indischer Religiosit√§t kann demnach noch beliehen werden. Es steht die Frage, wie die verschiedenen Atemweisen den ‚ÄěBe¬≠wusst¬≠seins¬≠strom‚Äú (William
James) unterhalten, kanalisieren und dynamisieren.
Vom Atem her gesehen ist menschliches Dasein Aufbau und Zerfall von Atemgestalten, die sich beim Hineinleben in
eine Situation wechselhaft ausbilden und unser Befinden tragen. Raum und Richtung sind die anthropologischen Begebenheiten, die wir vielf√§ltig mit unserem Leben in der Welt f√ľllen und die uns als sensorische
Grund¬≠formen der vielgestaltig ausdifferen¬≠zierbaren Atembewegung begegnen. Ilse Middendorf geb√ľhrt das historische Verdienst, die anthropologisch sinnhaften Formen der Atembewegung durch ihre thematischen
Übungsweisen am weitesgehendsten aufgeschlossen zu haben. Ihre empfindungsprägnante Arbeit etwa am Hintergrund, zur Ich­kraftbildung, an der Ver­wur­zelung, am Stand­punkt, mit dem Nabelfeld und
zur Entwicklung von Mitte entspricht biologischen Tendenzen zur Vollatembewegung.
Beispielhaft am Lampenfieber zeigt Fußer in einem zweiten Essay die existentialistische Bedeutung der
strukturgesetz¬≠lichen Atemgestalt, die Peripherieatem genannt wird. Mit dem Peripherieatem wird eine kurzwellige Schwingung bezeichnet, die nur als ein Hin- und Herzittern an der gesamten K√∂rperkontur sp√ľrbar ist
und weder beim Einatmen den Eigenraum weitet noch diesen beim Ausatmen verdichtet.
Das Lampen­fie­ber ist ein fixiertes Atemereignis. Bei dem pausenlosen Hin und Her bei der
Lampen¬≠fieber¬≠¬≠erregung geht der Mensch weder √ľber sich sensorisch in den Raum hinaus noch flieht er in sich selbst zur√ľck. Er spielt vielmehr auf der Schwelle von Innen und Au√üenwelt leibseelisch durch, was
nun auf ihn wartet, das von ihm abverlangen wird, sich als Person unverstellt zu expositionieren. Der vorgestellte Übungsaufbau zu dieser Atemweise erklärt die anthropologische Bedeutung der einzelnen
Arbeitsschritte. Was als Übung nicht schlichter anmuten könnte, offenbart einen tiefen Sinn. Ein Peri­pherie­atem bereitet Wandlungen vor.
Der Aufsatz ‚ÄěBewegung im Raum‚Äú qualifiziert die sensitive und kommunikative Bewegung, die in jeweiliger Art auch bei der Fel¬≠denkrais-Bewegung,
der Konzentrativen Bewegungstherapie sowie dem Tai Ch‚Äôi und der Glaserschen Psychotonik eingesetzt werden. Durch das beschauliche und langsame Ausf√ľhren von Bewegungen werden gewebliche Spannungen abgesenkt und
Unterspannungen angehoben. Die Atembewegung kann besser flie√üen. Die Middendorfarbeit geht √ľber diese Gemeinsamkeit der verschiedenen Arbeiten hinaus: Ihr Interesse zielt auf auf den Selbstbewegungs¬≠charakter der
Atembewegung. Der Mobilisierung durch sensitive Bewegungen, die vom Willen gef√ľhrt werden, folgt eine sich nunmehr von innen bildende unwillk√ľrliche Atembewegung, aus der eigene L√∂sungimpulse entstehen, die in
die Bewegung dr√§ngen. Diese von innen kommende Atembewegung wird mit Sammlungskraft, um sie in den unwillk√ľrlichen Ausdruck, die Mimik, die Geste und Ge¬≠b√§r¬≠de sowie den Tanz freigzugeben.
Die unwillk√ľrlichen ‚ÄěBewegung(en) aus dem Atem‚Äú machen uns unabweisbar darauf aufmerksam, dass das Innen nicht nur mit dem Au√üen iden¬≠¬≠tisch
ist, sondern sich auch von ihm unterscheidet. Es macht den individuierten Menschen aus, sich seine eigene Welt geschaffen zu haben. Er hat zwischen Binnenrealität und Außenwelt eine Mitte zu finden. Auch dieser
men¬≠schen¬≠kund¬≠liche Sachverhalt hat in der Atem¬≠erfah¬≠rung einen wiederum durch subtile √úbungsweisen belegten Namen: Substanzbildung im Atem. Wer √ľber sie verf√ľgt, erscheint so als Person, dass er
nicht √ľbersehen wird.
Nach dieser Fragestellung werden in einem weiteren Aufsatz die Möglichkeiten der Stimmarbeit untersucht. Er bestätigt die intuitive Erkenntnis
Humbolds, Herders und Gerbers, wonach der Charakter des stimmlichen Ausdrucks vor allem durch eine leibliche Tiefendimension bestimmt wird. In der Darstellung der Entwicklung der Atemarbeit mit dem Laut, wird
gezeigt, wie diese Intuition durch die praktischen Erkundungen der westlichen Atempioniere im vergangenen Jahrhundert eine St√ľtze erfahren hat.
Im dialogischen Geschehen der Atem¬≠behand¬≠lung ‚Äď so der f√ľhrende Gedanke des letzten Aufsatzes ‚Äď entsteht Transzendenz, weil die
Atembewe­gung die Immanenz sowohl zirkulären Selbstver­stehens der Iche als auch der phänomenalen Konstitution des fremden Subjekts in der eigenen Subjektivität durchbricht. Die Begegnung ist der Sprung in den
hermetischen Bereich der Person.
Das Buch ist nur √ľber den Atemraum zu erhalten
 zum Inhaltsverzeichnis und der Möglichkeit zur Leseprobe zum Inhaltsverzeichnis und der Möglichkeit zur Leseprobe
 Bestellen Bestellen
 Seitenanfang Seitenanfang
|